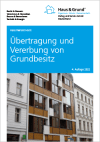- Mietverträge
- Digitale Signierung mit SCHUFA-Identitätsprüfung
- Betriebskostenabrechnung
- Webinare
» Jetzt informieren!
- Startseite
- Online-Produkte
- BonitätsManager
- Vermieterratgeber
- Shop
- Aktuelles
- Topthemen
- Wärmewende
- Wasserschäden durch Silikonfugen
- Kleinreparaturklausel
- Heizungsmodernisierung
- Erbrecht
- Nachbarrecht
- Themenarchiv
- Gebäudeversicherung
- Vermieterbefragung
- Vorkaufsrecht des Mieters
- Mietende
- Nachbarrecht
- Mietkaution
- Kosten für energetische Sanierungen
- Wohnungseigentum
- Nachbarrecht
- Indexmieten
- Energetische Sanierung
- Mieterhöhungen
- Sicherheit im Heizungskeller
- Kündigung wegen Eigenbedarfs
- Split-Klimageräte
- Smart Home
- Modernisierung
- Gewerberaummiete
- Glasfasernetze in Gebäuden
- Strom- und Gasrechnung
- Gartenhaus
- Teilschenkung
- Gewerbemietverträge
- Vermietung an WEG
- Verwalterentgeltstudie
- Modernisierungsmieterhöhung
- Maklerhonorar
- Photovoltaik-Anlagen
- Betriebskosten
- Wohnungseigentum
- Selbstnutzer im Nachteil
- Vermietete Eigentumswohnung
- Kaufpreisaufteilung für die Abschreibung
- Kostenverteilung in der GdWE
- Kinderreiche Familien
- Mieterhöhung
- Studie zur Bezahlbarkeit von Mieten
- Mietminderung
- Kehr- und Überprüfungsordnung
- Wohnrecht
- Grundsteuer
- Mietende
- Neue Gesetzgebung
- Sturmschäden
- Wohnraummietrecht
- Wohnkostenbelastung
- Grundsteuer
- Auswirkungen der Grunderwerbsteuer
- Wohnrecht
- Grundsteuerranking 2024
- Mietrechtsänderungen
- Mietkündigung und Räumungsklage
- Finanzierung
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Elektronische Rechnungen
- Mietendeckel
- Lastenzuschuss
- Zahlungsverzug
- Mietkündigung
- Wohnungseigentum
- Kürzung der Förderung von Energieberatungen
- Urteil zur Mietkaution
- Grundsteuer
- Einsparpotenzial im Neubau
- Entwicklung am Immobilienmarkt
- Heizung richtig warten
- Sanierungsmaßnahmen
- Kennzahlen der Wärmepumpe
- Immobilienkauf
- Kaution
- Grundsteuer-Bundesmodell
- Immobilienverwaltung in der GdWE
- Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern
- WohnKlima-Panel
- Nachbarrecht
- Vorweggenommene Erbfolge
- Aufteilung der Kohlendioxidkosten
- Jahressteuergesetz
- Heizungsgesetz
- CO2-Kostenaufteilung
- Wachstumschancengesetz
- Flächendefizit
- Schönheitsreparaturen
- Betreten vermieteter Wohnung durch Vermieter
- Aktuelles Mietrecht
- Solarpaket
- Kleinreparaturklausel
- Die Zukunft des Wohnens
- Bezahlbares Bauen und Wohnen
- Immobilienschenkung
- Dachwartung
- Gewerbemiete
- Heizungstausch
- Telekommunikationsgesetz
- Immobilienverkauf
- Mietkauf
- Grundsteuer
- Energieausweis
- Pressemitteilungen
- Presse-Archiv
- EBZ-Studie
- Bundesförderung für effiziente Gebäude
- Der Gaspreisdeckel
- Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz
- Energiesparend heizen, Schimmelpilz vermeiden
- Wohnen in Deutschland
- Auszeichnung durch Trusted Shops
- DIW-Studie
- Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Topthemen
- Kunden-Login
- Kunde werden
- Über uns
Erbrecht
Auslegungskünste - das „kryptische“ Testament
Rechtsanwalt Dr. Hans Reinold Horst, Hannover / Solingen
Immer wieder liest man: Machen Sie Ihr Testament und vermeiden Sie auf diese Weise Streit unter den Erben. Ein gut gemeinter und auch häufig richtiger Rat - aber: Allgemein bekannt ist, dass Juristen ihre eigene Fachsprache haben. Das gilt besonders im Erbrecht. Häufig werden dabei von Laien Fachbegriffe verwendet, deren Bedeutung entweder gar nicht klar ist, oder derer sie sich nur unscharf bewusst sind. Das gilt besonders im Erbrecht und hier bei der Formulierung des eigenhändigen Testaments (§ 2247 BGB). Auch wenn tatsächlich der bedachte begünstigte Erbe werden soll, liest man die Worte „ich vermache an X“, „X erhält …“ Oder „X bekommt“, anstatt „ich setze zu meinem alleinigen unbeschränkten Erben X ein. Oder etwa: „ich vererbe mein gesamtes Vermögen an X“; „zu meinen Erben bestimme ich X, Y und Z zu gleichen Anteilen. Man Nachlassvermögen soll wie folgt zwischen den genannten Erben aufgeteilt werden: …“
Häufig ist dann Streit vorprogrammiert. Denn es ist in diesen Fällen typischerweise schwierig, den wahren Willen des verstorbenen Erblassers zu ermitteln. Dann hilft nur die Auslegung der vorliegenden Erklärungen. Und hier feiert das Zitat Johann Wolfgang von Goethes häufig genug in Erbschaftsstreitigkeiten Urstand: „Im Auslegen seid frisch und munter. Legt ihr nicht aus, so legt was unter“.
Warum ist diese Ermittlung des wirklichen Erblasserwillens denn so wichtig?
Wer Erbe wird, erhält das Vermögen im Ganzen automatisch als eigenes Eigentum im Todeszeitpunkt (§ 1922 BGB). Abgesehen von Beschränkungsmöglichkeiten haftet er als Erbe für Nachlassverbindlichkeiten. Der Erbe erhält einen Erbschein auf Antrag als staatliches Zeugnis und Ausweis seines Erbrechts. Der Vermächtnisnehmer wird nicht Erbe. Er hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf Übertragung ihm testamentarisch zugewendeter einzelner Vermögensgegenstände oder Geldsummen gegen den Erben (§ 1939 BGB). Er wird also nicht automatisch Eigentümer im Todeszeitpunkt. Seinen Anspruch auf Erfüllung des Vermächtnisses muss er geltend machen. Weil er nicht Erbe wird, gibt es für ihn keinen Erbschein. Auch haftet er nicht für Nachlassverbindlichkeiten.
Obwohl sich diese Abgrenzungskriterien klarer lesen, kann die korrekte Ermittlung des Erblasserwillens im Einzelfall schwierig sein, wie der folgende Fall zeigt:
Es geht um ein Nachlassvermögen in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen €, bestehend aus Immobilien, Privatkonten, Anlage- und Sparkonten, Depotkonten, Barrengold, Schmuck und Bargeld. In seinem Testament formuliert der Verstorbene wie folgt:
„Mein Haus und Grundstück X-Weg 260 vererbe ich an E. Er hat sich stets um das Haus bemüht und mir bei der Instandhaltung geholfen. Von dem sonst vorhandenen Vermögen vermache ich an Frau F 20.000 € für ihre langjährige Hilfe und die Pflege meiner verstorbenen Mutter. Frau G erhält 50.000 €, die sie für ihre Rente anlegen soll. Frau U erhält das Barrengold und 100.000 €. Das übrige Barvermögen erhält Herr Y. Der Schmuck soll aufgeteilt werden wie in der anliegenden Liste.“
E, dem das Hausgrundstück zugewendet worden ist, beantragt einen Erbschein, der ihn als Alleinerben ausweist. Herr Y, der sich über das übrige Barvermögen freuen darf, legt gegen den erteilten Erbschein Beschwerde ein. Er macht geltend, durch das Testament selbst zum Alleinerben berufen worden zu sein. Dafür stützt er sich auf einer Auslegung des Testaments; das Immobilienvermögen mache nur einen Anteil von knapp einem Drittel des gesamten Nachlassvermögens aus. Ihm selbst sei dagegen das sonstige Bar- und Bankvermögen im Wert des doppelten Betrags zugewendet worden. Das Amtsgericht hilft der Beschwerde nicht ab und legt die Sache dem Oberlandesgericht zur Entscheidung vor. F, G und U wollen geklärt wissen, von wem sie ihr Geld bekommen.
Zunächst zum Erbschein und damit zur Erbenstellung:
Das OLG Düsseldorf gibt der Beschwerde statt und „kassiert“ den bereits ausgestellten Erbschein zu Gunsten des E (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.2.2025 -3 Wx 216/24, NJW 2025, S. 2408 = NJW-RR 2025, 773 ff). Die Gründe: Eine Auslegung des Testaments ergebe, dass sowohl E als auch Y zu Miterben berufen worden seien. Dabei entfalle auf Y eine Erbquote von 2/3 und auf E eine Quote von 1/3. Die Analyse der Entscheidungsgründe zeigt folgende Kriterien als maßgeblich für dieses Auslegungsergebnis:
- Mit dem Testament hat der Erblasser über sein Vermögen im Ganzen verfügt. Das spricht dafür, dass er Erben bestimmen wollte. Lebensfern erscheint es auch, wenn man nur Vermächtnisse aussetzt, ohne Erbenregelungen zu treffen.
- Der Wortlaut des Testamentes ist nicht eindeutig im Hinblick auf die Frage, wer Erbe sein soll. Es finden sich teilweise auch als Synonym verwendet Formulierungen wie „vererbe“ oder „erhält“, ohne dass der Wille ersichtlich ist, in dem einen Fall einen Erben zu berufen und in dem anderen Fall ein Vermächtnis auszusetzen.
- Bleibt der Wortlaut insofern auslegungsfähig und auch auslegungsbedürftig, so kann sich die Erbenstellung auch aus der testamentarischen Zuwendung bestimmter Gegenstände oder bestimmter Gruppen von Gegenständen ergeben. Dies spricht zwar zunächst nach der Auslegungsregel in § 2087 Abs. 2 BGB für die Anordnung eines Vermächtnisses, weil eben nur bestimmte Vermögensgegenstände oder bestimmte Gruppen von Gegenständen genannt sind. Wendet der Erblasser allerdings vom Wert her besonders wertvolle einzelne Gegenstände (Hauptnachlassgegenstände) einzelnen Personen zu, oder teilt er sein Vermögen im Verhältnis ca. 2/3 zu ca. 1/3 zwischen 2 Personen auf und bedenkt mehrere weitere Beteiligte nur mit Zuwendungen in Höhe von einem Prozent bis 7 % des gesamten Nachlassvermögens, so spricht dies dafür, dass es 2 Miterben geben soll, während die restlichen Beteiligten von der zugewendeten Vermögensquote her und von den einzelnen bestimmten Gegenständen als Vermächtnisnehmer anzusehen sind.
- Für die Ermittlung einzelner Quoten gelten die zugewendeten Vermögensmassen als Basis (ebenso: BGH, Urteil vom 16.10.1996 - IV ZR 349/95 mit weiteren Nachweisen).
- Bei der Auslegung des Testamentes bleibt unbeachtlich, ob einer der Miterben besonders eng mit dem Erblasser befreundet war, sodass deswegen auf eine eventuelle Stellung als Alleinerbe zu schließen wäre. Ohne Belang bleibt auch die Reihenfolge, in der die Beteiligten im Testament genannt werden, denen etwas zugewendet wird.
- Schließlich kommt der Tatsache keinerlei rechtliche Relevanz bei der Ermittlung des Erblasserwillens durch Auslegung seiner Verfügung von Todes wegen zu, dass bereits einer der genannten Beteiligten über eine Generalvollmacht verfügte und deshalb der Erblasser keine Notwendigkeit gesehen haben mag, testamentarisch noch über weiteres Geldvermögen zu testieren. Sehr pointiert bezeichnet das OLG Düsseldorf (Rn. 36 der Entscheidungsgründe am Ende) diesen Sachvortrag als „ergebnisgeleitet ins Blaue hinein ohne einen tatsächlichen Anknüpfungspunkt“.
Aus dieser testamentarischen Auslegung folgt als Zwischenergebnis, dass E und Y als Miterben durch die ausgesetzten Vermächtnisse gemeinsam beschwert sind.
Dann zu der Frage: Wer muss nun in welcher Höhe die Vermächtnisse erfüllen?
Was nun die Erfüllung des Übertragungsanspruchs der Vermächtnisnehmer angeht, so bestimmt § 2148 BGB zunächst nur als Auslegungsregel, dass mehrere Miterben grundsätzlich nach dem Verhältnis ihrer Erbteile beschwert sind. Das hätte zur Folge, dass E 1/3 und Y 2/3 des Vermächtniswertes bei geltend gemachten Übertragungsansprüchen zu erfüllen hätte. Der erkennbare testamentarisch niedergelegte Wille des Erblassers kann aber dieser Auslegungsregel entgegenstehen. Dieser testamentarische Wille ergibt nach Auffassung des OLG Düsseldorf (Rn. 45 der Entscheidungsgründe), dass die ausgesetzten Vermächtnisse aus dem sonstigen Nachlass erfüllt werden. Und das bedeutet nach Auffassung des Gerichts, dass die Miterben unabhängig von ihrer Erbquote wirtschaftlich zu gleichen Teilen erfüllen müssen.
Hintergrund:
Bei der Auslegung von Testamenten kommt es auf die Ermittlung des wirklichen Willens des Erblassers an, nicht auf den buchstäblichen Sinn der Formulierungen im Testament. Der Wortlaut ist also nicht allein maßgeblich, sondern muss hinterfragt werden. Dies hat unter Berücksichtigung aller zugänglichen Umstände außerhalb der Testamentsurkunde nach dem gesamten Streitstoff der mündlichen Verhandlung durch den Tatrichter zu erfolgen. Auch auf Schriftstücke, die der Testamentsform nicht genügen, kommt es dabei an. Allerdings muss sich zumindest andeutungsweise oder versteckt aus dem Testament selbst der Wille des Erblassers ergeben, bestimmte Personen zu Erben zu bestimmen (OLG Düsseldorf, a. a. O., Rn. 17 der Entscheidungsgründe). Das Gericht dort wörtlich: „Denn eine Erbeinsetzung, die in dem Testament nicht enthalten und nicht einmal angedeutet ist, ermangelt der gesetzlich vorgeschriebenen Form und ist daher gemäß § 125 Satz 1 BGB nichtig (vgl. auch: BGH, Beschluss vom 14.9.2022 – IV ZB 34/21 mit weiteren Nachweisen). Dementsprechend müssen für eine infrage stehende testamentarische Anordnung des Erblassers wenigstens gewisse Anhaltspunkte in der letztwilligen Verfügung enthalten sein, die im Zusammenhang mit den sonstigen heranzuziehenden Umständen außerhalb des Testaments den entsprechenden Willen des Erblassers erkennen lassen (BGH, Beschluss vom 10.11.2021 - IV ZB 30/20 mit weiteren Nachweisen)“.
Zur gesetzlich angeordneten Form eines privatschriftlichen, also selbst verfassten Testaments folgendes: Das Testament muss handgeschrieben und unterschrieben sein (§ 2247 Abs. 1 BGB). Wird diese Form nicht gewahrt, so ist es nichtig.
Insgesamt gilt zur Abgrenzung zwischen Erbenstellung sowie der Stellung eines Vermächtnisnehmers nach der Rechtsprechung folgendes: Entscheidend ist, ob der Erblasser dem bedachten eine Rechtsstellung am Nachlass als Ganzes verschaffen wollte und ihn mit Abwicklung und Verwaltung betrauen wollte. Dann liegt eine Erbeinsetzung vor. Dagegen ist von der Stellung eines Vermächtnisnehmers auszugehen, wenn der Erblasser den Bedachten von der unmittelbaren Herrschaft und Verantwortlichkeit ausschließen wollte (BGH, Beschluss vom 12. Juli 2017 – IV ZB 15/16, NJW-RR 2017, 1035; OLG Hamburg, Beschluss vom 6. Oktober 2015 – 2 W 69/15, FamRZ 2016, 1808; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 30. März 2022 – 5 W 15/22, NJW-RR 2022, 1021; Grüneberg-Weidlich, BGB, 84. Aufl. 2025, § 2087 BGB Rn. 4).
Möchten Sie Ihr Testament wirklich gerichtsfest formulieren?